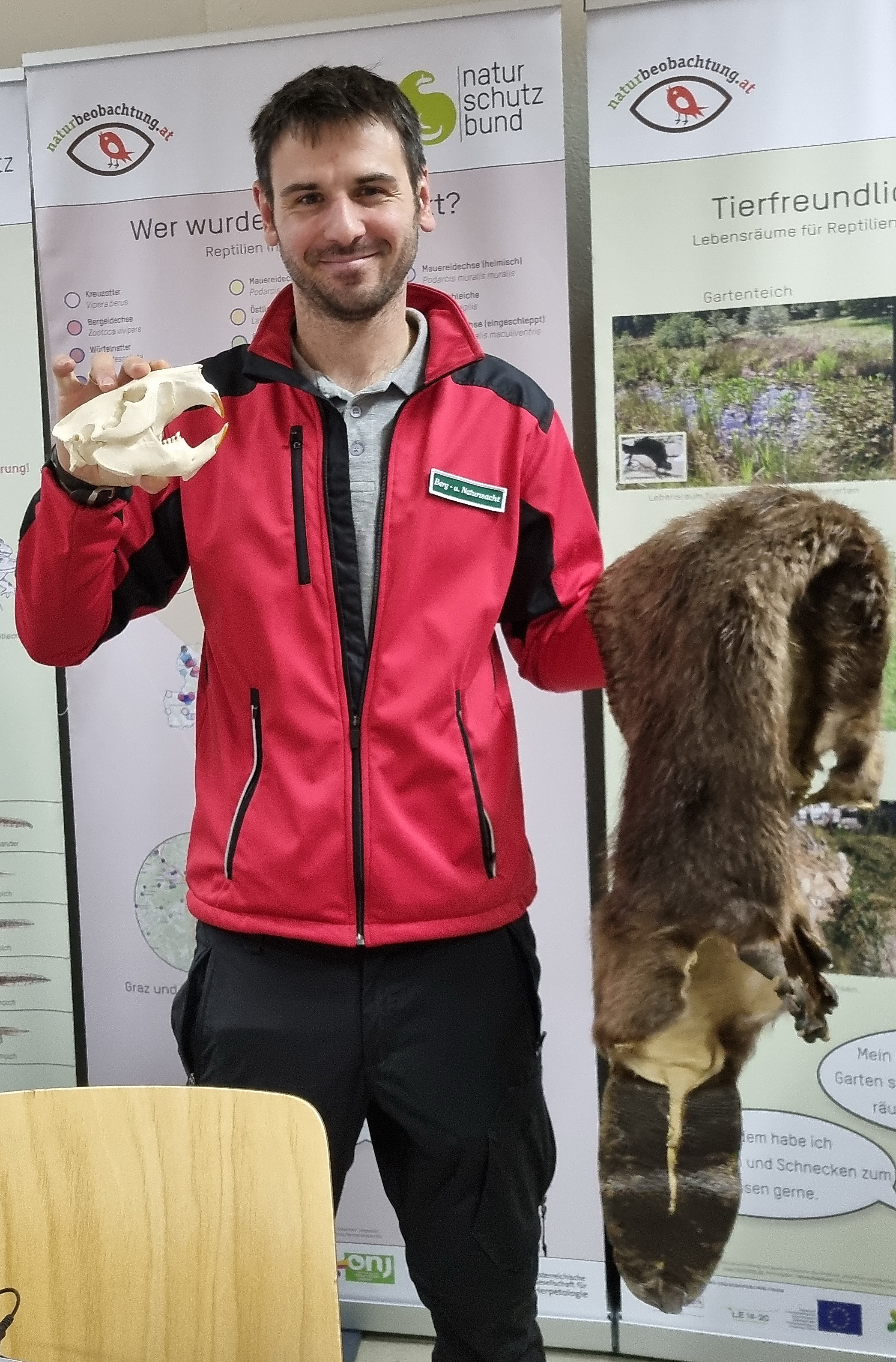„Ziel im Umgang mit dem Biber für die Zukunft muss sein, dass er als ganz normaler Teil unserer Landschaft wahrgenommen wird und dass Konflikte mit menschlichen Nutzungsansprüchen minimiert werden“ - Christof Angst, Biberfachstelle Schweiz
Biberkonflikte
Die Konflikte, die sich durch das Zusammenleben von Mensch und Biber ergeben, sind vielfältig und hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sehr unterschiedlich einzustufen. Nach Zahner et al. (2005) lassen sie sich - in Abhängigkeit von den Aktivitäten des Bibers - vier Themenbereichen zuordnen.
Fressen von Feldfrüchten
Als reine Pflanzenfresser ernähren sich Biber von einem breiten Spektrum an krautigen Pflanzen und Gehölzen im Nahbereich von Gewässern. Sie sind auch in der Lage, sich auf neue Futterpflanzen rasch einzustellen und nehmen diese dann in ihr Nahrungsspektrum auf. Dazu zählen in erster Linie Kulturpflanzen wie Mais, Zuckerrüben, Raps und Getreide, in manchen Gebieten werden auch Karotten, Kohl und Sellerie gefressen.
Die Größe der vom Biber abgeernteten Fläche hängt einerseits von der Fruchtart und ihrer Reifezeit bis zur Ernte und andererseits vom Reviertyp und damit der Anzahl an Tieren im Revier ab.
Der wirtschaftlich Schaden, der sich durch das Fressen von Feldfrüchten ergibt, ist meist relativ gering, da Biber einerseits nur so viele Pflanzen entnehmen, wie sie auch tatsächlich fressen und andererseits die Anzahl an Tieren am Gewässer durch das Reviersystem limitiert ist (Zahner et al. 2005). Die Erfahrungen aus anderen Bundesländern haben gezeigt, dass – auch wenn alle sichtbaren Flecken eines Fruchtausfalls auf einem Acker zusammengezählt werden – dieser 1.000 m2 nicht übersteigt (Hölzler & Parz-Gollner 2018).
|

Mais zählt zu den beliebtesten Futterpflanzen des Bibers
© B. Komposch
|

Biberfraß in einem Getreidefeld
© B. Komposch
|
Fällen von Gehölzen
Biber ernähren sich vor allem in den Wintermonaten von der Rinde von Weichhölzern wie Weiden und Pappeln. Da die Borke am Stamm wenig nahrhaft ist, müssen Biber Bäume fällen, um an die saftigere Rinde der Zweige zu kommen. Als Baumaterial für Dämme und Burgen werden auch Zweige und Äste anderer, z. T. forstwirtschaftlich wertvoller Gehölze (Eichen, Eschen, Fichten), Obstbäume und Ziergehölze wie z. B. Thujen gefällt, wenn sich diese im Nahbereich eines vom Biber genutzten Gewässers befinden.
Ein Biber braucht im Winter etwa 700 bis 900 g Rinde pro Tag. Hochgerechnet auf eine Wintersaison entspricht das ungefähr 20 Bäumen mit einem Brusthöhendurchmesser von 18 cm (Zahner et al. 2005).
Gravierend können sich die Folgen der Fällungen auswirken, wenn Bäume auf Infrastruktureinrichtungen wie z. B. Straßen oder Stromleitungen fallen und dadurch die Verkehrssicherheit bzw. Stromversorgung beeinträchtigen. Bewirtschaftungserschwernisse können die Folge sein, wenn gefällte Bäume auf angrenzende Felder oder Mähwiesen stürzen. Größere Äste, die ins Gewässer fallen, können als Treibgut die Funktionsfähigkeit von Wehranlagen und Triebwerksrechen beeinflussen. In kleineren Gewässern können gefällte Bäume zu Verklausungen führen und in weiterer Folge den Hochwasserabfluss behindern.
Das Entfernen und Aufarbeiten der Bäume ist mit einem zum Teil erheblichen Arbeitsaufwand verbunden und verursacht Kosten.
|
 In Spalier-Obstplantagen können Biber in wenigen Nächten zahlreiche Bäume fällen. In Spalier-Obstplantagen können Biber in wenigen Nächten zahlreiche Bäume fällen.
© B. Komposch
|
 Biberfällungen im Nahbereich von Siedlungen können zu Konflikten führen. Biberfällungen im Nahbereich von Siedlungen können zu Konflikten führen.
© B. Komposch
|
|

Auf Ackerflächen gestürzte Bäume sind ein Ärgernis für den Bewirtschafter.
© B. Komposch
|

Vom Biber angenagte/gefällte Fichten
© B. Komposch
|
Grabaktivitäten
Biber legen ihre Baue meist in der Uferböschung von Gewässern an. Dazu graben sie Röhren in das Erdreich, die mehrere Meter lang sein können und an deren Ende sich der Wohnkessel befindet. Daneben legen sie auch einfache Röhren an, die sie als Rast- und Ruheplätze nutzen. Biber graben auch „Tunnel“ zu angrenzenden Futterflächen, um diese geschützt erreichen zu können.
Diese Grabaktivitäten des Bibers können zu erheblichen Beeinträchtigungen führen. Einerseits kann es dazu kommen, dass gewässernah verlaufende Straßen, Wege und Nutzflächen unterhöhlt werden und einbrechen, andererseits können Schutzdämme oder Deiche von z. B. Fischteichen durch die angelegten Röhren undicht werden. Die Folge sind Schäden an Fahrzeugen und landwirtschaftlichen Geräten, Vernässungen von Acker- und Wiesenflächen und damit in Verbindung stehende Bewirtschaftungserschwernisse, Wasserschäden an Gebäuden oder das Auslaufen von Fischteichen. Auch Personenschäden sind in solchen Fällen nicht auszuschließen.
Diese Art von Konflikten tritt häufig in jenen Bereichen auf, in denen die Bewirtschaftung/Nutzung bis zur Gewässeroberkante reicht.
|

Eingebrochene Biberröhre
© B. Komposch
|

Biberröhre, die zu einem Getreidefeld führt.
© B. Komposch
|
|

Frisch sanierte Bibereinbrüche an einem gewässerparallel verlaufenden Weg.
© B. Komposch
|

Vom Biber in einen Maisacker gegrabener Kanal.
© B. Komposch
|
Dammbauaktivitäten
Biber legen Dämme an, um Gewässer aufzustauen und damit nutzbar zu machen. Dadurch wird zum einen sichergestellt, dass der Eingang zum Biberbau bzw. den Röhren unter Wasser liegt, zum anderen können Nahrung und Baumaterial vom Biber schwimmend transportiert werden.
Über das Jahr gesehen brauchen Biber eine Mindestwassertiefe von 80 cm.
Biberdämme können weitreichende Auswirkungen haben. Häufig werden durch den erhöhten Wasserspiegel Auslässe von Felddrainagen eingestaut, wodurch deren Funktionsfähigkeit beeinträchtigt wird und es z. B. zur Vernässung von Ackerflächen kommt. Reichen Biberdämme bis zur Böschungsoberkante, kann es zu einem Wasseraustritt in die angrenzenden Flächen kommen. Das führt zu erschwerten Bedingungen bei der Ernte bzw. zu Ertragsminderungen oder -ausfällen. An kleineren Gewässern kann der Hochwasserabfluss durch Dämme behindert werden. Werden Dämme im Bereich von Kläranlagen, Rückhaltebecken oder Fischteichen gebaut, kann es zu einer Beeinträchtigung der Wasserzufuhr bzw. des -ablaufs und damit der Funktionsfähigkeit der Anlagen kommen.
|

Wasseraustritt in Maisacker
© B. Komposch
|

Vom Biber stark aufgestautes Gewässer
© B. Komposch
|
|

Wasseraustritt infolge eines Biberdamms
© B. Komposch
|

Vom Biber eingestauter Rohrauslass
© B. Komposch
|
Schadensprävention
Unter dem Begriff Prävention werden all jene Maßnahmen zusammengefasst, die das Auftreten von Biberschäden verhindern sollen.
Einzelbaumschutz
Einzelbaumschutz kann in Form von Gittern oder Verbiss-Schutzmitteln (WÖBRA) durchgeführt werden. In Einzelfällen ist auch eine flächige Zäunung z. B. bei Obstbaum-Neuanlagen oder Aufforstungen sinnvoll. Für die Ummantelung eignen sich z. B. Estrichmatten, die in der üblichen Handelsgröße (2 x 1 m), ohne Zuschnitt, mit 5 bis 10 cm Abstand um den Baum gewickelt und mit Draht oder Kabelbindern fixiert werden.
Die Gitter müssen aus Eisen bzw. verzinkt sein, eine Drahtstärke von mind. 1,5 mm und eine möglichst kleine Maschenweite aufweisen. Die Höhe des Gitters muss mind. 1 m hoch sein.
Für das Verbiss-Schutzmittel WÖBRA ist ein Sachkundenachweis für den Erwerb von Pflanzenschutzmitteln erforderlich!
Wichtig:
Bereits gefällte Bäume liegen lassen bis zum nächsten Frühjahr um die Fällaktivität nicht anzuregen. Der Biber kann so das Gehölz aufarbeiten und man provoziert keine neuen Fällungen. Massiv angefressene Bäume brauchen nicht mehr geschützt werden. Wenn Baumschutzmaßnahmen korrekt gesetzt werden, hat man für sehr lange Zeit keine Konflikte mehr!
|

Frisch mit WÖBRA angestrichene Fichten
© B. Komposch
|

Einzelbaumschutz in Form eines Gitters
© B. Komposch
|
Elektrozäune
Durch das Aufstellen von Elektrozäunen kann der Biber daran gehindert werden z. B. in Ackerflächen einzudringen. Da Biber auf Stromschläge sehr empfindlich reagieren und diese Stellen dann meiden, muss der Zaun meist nur vorübergehend errichtet werden. Über Biberdämme gespannte Elektrozäune mit herabhängenden Litzen verhindern, dass diese höher aufgebaut oder an problematischen Stellen errichtet werden.
|

Elektrozaun zum Schutz von Feldfrüchten
© G. Hölzler
|

Elektrozaun mit herabhängenden Litzen zur Regulierung der Dammhöhe
© B. Komposch
|
Dammdrainage
Durch den Einbau einer Dammdrainage in einen Biberdamm kann der Wasserstand auf ein „Kompromissniveau“ eingestellt werden. So werden einerseits Konflikte vermieden und andererseits kann der Biber das Gewässer weiterhin nutzen. Eine Mindestwassertiefe von 80 cm muss dabei jedoch erhalten werden und eine regelmäßige Wartung der Anlage ist erforderlich.
Für den Einbau einer Dammdrainage ist eine wasserrechtliche Bewilligung erforderlich!
|

Einbau einer Dammdrainage
© B. Komposch
|

Dammdrainage mit geschlitzten Rohren
© B. Komposch
|
Sonstige Maßnahmen
Durch den Einsatz von Drahtgeflechten an Zu- und Abläufen von Fischteichen sowie an Durchlässen kann ein Verstopfen derselben durch den Biber unterbunden werden. Ein Untergraben von Dämmen und Deichen wird durch den Einbau eines Grabschutzes (Versteinung, Drahtgitter, Spundwände und ähnliches) verhindert. Derartige Maßnahmen sind in der Regel jedoch sehr kostspielig. Bei Neuanlagen in Bibergebieten sollten derartige Sicherungsmaßnahme grundsätzlich vorgesehen werden.
Entschädigungen für bereits aufgetretene Schäden werden nicht geleistet.
Da die Mehrzahl der Biberkonflikte im unmittelbaren Nahbereich von Gewässern auftritt, stellt die Anlage von Uferrandstreifen eine der wichtigsten und wirksamsten Maßnahmen zur Verhinderung von Biberkonflikten dar. Diese Maßnahme dient nicht nur dem Biber, sondern fördert auch viele andere Tierarten (Bayerisches Landesamt für Umwelt & Bund Naturschutz in Bayern 2009a und 2009b, Sommer et al. 2019), wirkt sich positiv auf den Gewässerschutz und die Gewässerentwicklung aus und stellt eine Form des Hochwasserschutzes dar (Zahner et al. 2005, Zahner 2013).
Präventionsmaßnahmen werden vom Land Steiermark, Abteilung 13 Umwelt und Raumordnung, Referat Naturschutz gefördert
Nähere Infos unter:
Flächenförderung
Landwirtschaftlich genutzte Flächen, die in ihrer Bewirtschaftung durch Biberaktivtäten beeinträchtig werden, können im Rahmen des Landesvertragsnaturschutzes (LAV) gefördert werden. Förderfähig sind Grünland- und Ackerflächen angrenzend an Gewässer, an denen Bibervorkommen nachgewiesen sind. Die Vertragsfläche wird von den Gutachter*innen festgelegt.
Nähere Infos unter:
[>] Bayerisches Landesamt für Umwelt (2009a): Biber in Bayern. Biologie und Management. LfU, Augsburg, 48 S., www.lfu.bayern.de
[>] Bayerisches Landesamt für Umwelt (2009b): Das Bayerische Bibermanagement. Konflikte vermeiden - Konflikte lösen. LfU, Augsburg, 8 S., www.lfu.bayern.de
[>] Hölzler, G. & Parz-Gollner, R. (2018): Die Biber-Praxisfibel. Maßnahmen zur Konfliktlösung im Umgang mit dem Biber Castor fiber. BOKU Wien, 94 S.
[>] Paine, R. T. (1969): A Note on Trophic Complexity and Community Stability. The American Naturalist 103 (929): 91–93.
[>] Sommer, R., Ziarnetzky, V., Messlinger, U. & Zahner, V. (2019): Der Einfluss des Bibers auf die Artenvielfalt semiaquatischer Lebensräume. Naturschutz und Landschaftsplanung 51: 108-115.
[>] Zahner, V., Schmidbauer, M. & Schwab, G. (2005): Der Biber. Die Rückkehr der Burgherren. Buch & Kunstverlag Oberpfalz, 136 S.
[>] Zahner, V. (2013): Hat der Biber Einfluss auf Wasserhaushalt und Hochwasser? Natur & Land 99: 15-17.
 Berg- und Naturwacht Steiermark
Berg- und Naturwacht Steiermark Entwicklung des ländlichen Raums 2014-2020
Entwicklung des ländlichen Raums 2014-2020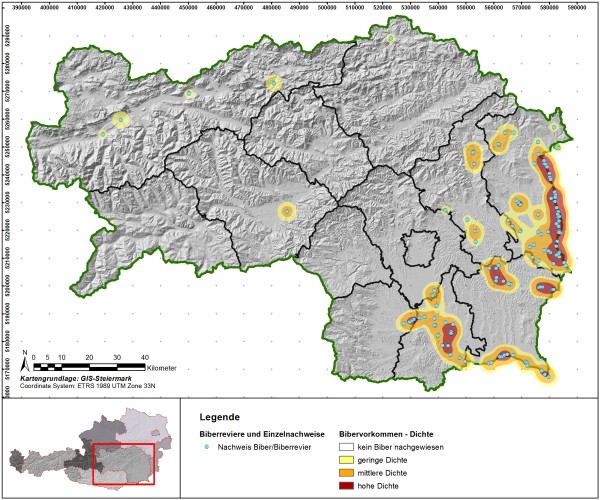
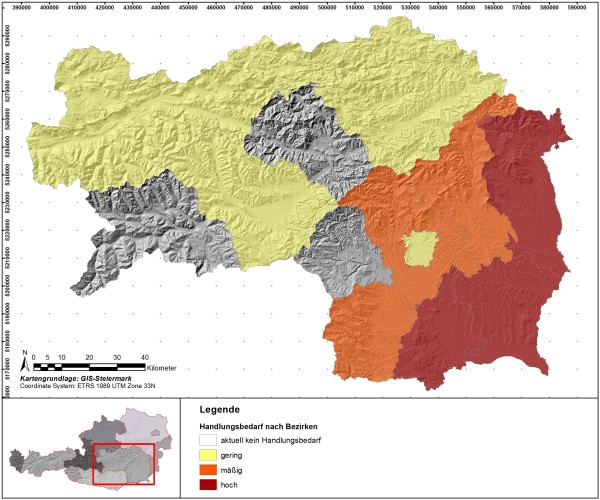



 In Spalier-Obstplantagen können Biber in wenigen Nächten zahlreiche Bäume fällen.
In Spalier-Obstplantagen können Biber in wenigen Nächten zahlreiche Bäume fällen. Biberfällungen im Nahbereich von Siedlungen können zu Konflikten führen.
Biberfällungen im Nahbereich von Siedlungen können zu Konflikten führen.